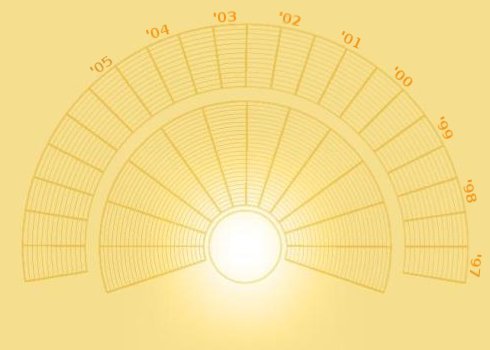So gab er sich in die Hand des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, eine Hand, die auf dem Leben seines einzigen Sohnes schwer gelastet hat.
Württembergische Zustände
Das Königreich Württemberg ist heute ein sehr bescheidener Mittelstaat, aber das Herzogtum Württemberg, aus dem es entstanden ist, war im achtzehnten Jahrhundert noch viel kleiner; es umfaßte noch nicht zweihundert Geviertmeilen und zählte etwa eine halbe Million Einwohner. Immerhin erschien es wie eine Art Großstaat in dem schwäbischen Reichskreise, wo die deutsche Zersplitterung ihren höchsten Grad erreichte und sich einige neunzig Reichsstände, vier geistliche und dreizehn weltliche Fürsten, dreißig Reichsstädte, zwanzig Abteien und eine Anzahl Reichsgrafschaften, ungerechnet zahllose Reichsritter, in ein Gebiet von 729 Geviertmeilen teilten.
Mehr aber als durch seine verhältnismäßige Größe im schwäbischen Reichskreise zeichnete sich Württemberg im Heiligen Römischen Reiche Deutscher Nation durch seine Verfassung aus. Sie bestand in jenem "alten guten Recht", von dem Uhland später so beweglich gesungen und von dem noch vor Uhland der berühmte englische Staatsmann Fox in allem Ernste gemeint hat, es gebe in Europa nur zwei Verfassungen, die den Namen verdienten, die englische und die württembergische. In der Tat war die Macht des Herzogs von Württemberg wesentlich eingeschränkt durch die Rechte der Stände, mit denen die deutschen Despoten sonst ziemlich aufgeräumt hatten, außer in Mecklenburg und eben in Württemberg. Jedoch unterschieden sich diese beiden Ausnahmen wieder dadurch, daß in den mecklenburgischen Ständen das Junkertum regierte, während es in den württembergischen Ständen gar nicht vertreten war. Die schwäbischen Junker hatten es vorgezogen, sich als Reichsgrafen oder Reichsritter reichsunmittelbar zu machen, so daß die württembergischen Stände aus 14 Vertretern der Geistlichkeit und 68 von den Magistraten gewählten Vertretern der Städte und Ämter bestanden, was ihnen einen sozusagen modernen Anstrich gab.
Indessen feudale Stände bleiben immer feudale Stände. Die Magistrate der Städte und Ämter waren ein erbgesessener, zünftig beschränkter Klüngel, der sich schroff in sich selbst absperrte, und der alte ehrliche Schlosser kam der Wahrheit näher als die Bewunderer der württembergischen Verfassung, wenn er meinte, Württemberg habe an allen Übeln der aristokratischen und der monarchischen Gewalt gelitten. Der Landtag trat selten zusammen; seine Befugnisse lagen in den Händen des großen und des kleinen Ausschusses, von denen der kleine Ausschuß beständig tagte und sich selbst ergänzte. Er verwaltete die landschaftliche Steuerkasse nach freiem Ermessen und trieb im Interesse des bürgerlichen "Herrenstandes" eine unbeschränkte Gevatterschaftspolitik. Selbst der Held und Märtyrer dieser Stände, Johann Jacob Moser, verschloß sich der Einsicht nicht, daß die Mitglieder einzig darauf bedacht seien, die alten Mißbräuche zu erhalten, ihre Anverwandten auf Kosten des Landes zu versorgen und sich jeder Reform mit allen Kräften zu widersetzen. Ober die geistlichen Mitglieder der Stände urteilte Moser nicht günstiger als über die bürgerlichen. Württemberg war der Hauptpfeiler des Protestantismus im südlichen Deutschland; seine Landeskirche hatte sich das gesamte Besitztum der katholischen Kirche zu erhalten gewußt und gebot über die Einkünfte von 450 Ortschaften. Sie prägte dem geistigen Leben der Bevölkerung ihren Stempel auf und hielt auf ein gewisses Maß von Bildung, soweit es ihren Interessen entsprach. Die Klosterschulen in Urach, Blaubeuren und Maulbronn hatten kaum einen geringeren Ruf als die sächsischen Fürstenschulen, und nächst dem kursächsischen galt der schwäbische Kandidat als der beste Hauslehrer. Auch die Landesuniversität Tübingen und in erster Reihe ihr theologisches Stift erfreuten sich eines großen Rufes. Allein auch dieser erträglichste Teil der ständischen Wirtschaft war längst in schweren Verfall geraten, und Moser klagte, daß die württembergischen Prälaten die Universität Tübingen nicht weniger verwüsteten als die bayrischen Jesuiten die Universität Ingolstadt.
Es ist nicht sowohl ein Lob als ein Tadel für die württembergischen Herzöge, mit der Landschaft, wie sich die Stände nannten, nicht gründlich aufgeräumt zu haben. Der moderne Absolutismus war selbst in der traurig verkümmerten Form, wie er sich in dem zersplitterten Deutschland nur hat entwickeln können, ein historischer Fortschritt gegen das feudale Ständewesen. Respekt vor Gesetz und Recht hinderte sie am wenigsten; "unsere Fürsten sind immer böse Kerle gewesen", pflegten die Altwürttemberger mit naivem Stolze zu sagen. Aber der Typus jenes Herzogs Ulrich, dem die Stände im Tübinger Vertrage von 1514 ihre Gerechtsame abgetrotzt hatten - unter gemeinsamem Verrat des Armen Konrads, der gegen die Bedrückungen Ulrichs aufständigen Bauern - , herrschte unter seinen Nachfahren vor: ein Typus, den Hutten in flammenden Reden gebrandmarkt hat. Es war ein blutsaugerisches, verschwenderisches, in allen Ausschweifungen und Lastern sich wälzendes, aber politisch unfähiges Geschlecht, das den Ständen niemals den miles perpetuus, das unbeschränkte Recht der Steuererhebung und der Rekrutenaushebung, zu entreißen wußte. Nur der Herzog Friedrich nahm im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts einen Anlauf dazu, starb aber, ehe er zum Ziele gelangte, und sein Kanzler Enslin büßte auf dem Schafott für den Versuch, die Rechte der Landschaft angetastet zu haben.
Der Dreißigjährige Krieg verwüstete das Land aufs ärgste. Gleichwohl begann jetzt eine Mißwirtschaft der Herzöge, die ziemlich anderthalb Jahrhunderte währte und nur ein paarmal durch vormundschaftliche Regierungen gemäßigt wurde. Diesen Beutelsbachern fehlte gar sehr, was bei den Wittelsbachern in München und Mannheim, bei den Welfen in Hannover und Braunschweig, bei den Wettinern in Dresden und Weimar doch hin und wieder auftauchte, ein Bewußtsein ihrer fürstlichen Pflichten, ein Interesse an dem Gemeinwohl, eine Sorge für Kunst und Wissenschaft, und sei es auch nur zu dem Zwecke, ihren Hof mit einem berühmten Namen zu schmücken. Die württembergischen Dynasten waren Wüstlinge in jedem blöden wie in jedem nichtsnutzigen Sinne des Worts: Eberhard III., von dem sein eigener Hofprediger schon fünf Jahre nach dem Schlusse des Dreißigjährigen Krieges klagte, daß ein unerhörter Luxus des Hofes verzehre, was dem armen ausgesaugten Volke noch ausgepreßt werden könne; dann Eberhard Ludwig, der von der Metze Grävenitz jahrzehntelang das Land ausplündern ließ; weiter Karl Alexander, unter dem der Jude Süß die schamlosesten Erpressungen betrieb.
Dieser Karl Alexander, der aus einer Seitenlinie auf den Thron gelangte, hatte lange in österreichischen Kriegsdiensten gestanden und war katholisch geworden, weshalb ihn die Landschaft mit höchstem Mißtrauen betrachtete, solange er in Stuttgart regierte. Er soll auch eine Gegenreformation geplant haben, hatte aber noch keine öffentlichen Anstalten dazu gemacht, als er im Jahre 1737 plötzlich starb. Er hinterließ eine Witwe, eine berüchtigte Kurtisane der damaligen Zeit, und drei unmündige Knaben, die anfangs in Stuttgart, dann aber in Berlin erzogen wurden. Es geschah mit Bewilligung und eher wohl noch auf Betreiben der Stände, die ein begreifliches Interesse daran hatten, mit dem größten protestantischen Hofe in gutem Einvernehmen zu stehen, wie denn auch der preußische König Friedrich, der eben zur Regierung gelangt war, alles Interesse daran hatte, sich den größten protestantischen Staat in Süddeutschland zu verpflichten. Weniger einverstanden war der älteste der drei Knaben selbst, und um ihn sich zu verbinden, ließ ihn Friedrich bereits im Alter von sechzehn Jahren, im Jahre 1744, durch den damaligen wittelsbachischen und von Friedrich abhängigen Kaiser Karl für großjährig erklären, sandte ihn mit einem schriftlichen, von weisen Ratschlägen triefenden Prinzenspiegel als fertigen Herzog nach Stuttgart zurück und verlobte ihn obendrein mit seiner Nichte, der einzigen Tochter seiner Lieblingsschwester von Bayreuth.
Jedoch erwies er sich dabei als ebenso schlechter Menschenkenner wie ein paar Jahrhunderte früher der Kaiser Maximilian, der den sechzehnjährigen Herzog Ulrich ebenfalls für großjährig erklärt und mit seiner Nichte vermählt hatte. Wie Herzog Ulrich, so lohnte Karl Eugen seinem Wohltäter sehr übel. Anfangs zwar sah sich die Sache leidlich an, da der junge Mensch die vormundschaftliche Regierung weiter wirtschaften ließ und sich damit begnügte, die Erträge seines großen Kammerguts durchzubringen. Mit dem Essen kam aber der Appetit, und im Jahre 1752 begann der Herzog schon, Blut und Leben seiner "Untertanen" an eine auswärtige Macht zu verhandeln: er schloß auf sechs Jahre einen sogenannten Subsidienvertrag mit Frankreich, worin er sich verpflichtete, gegen jährliche Zahlung von 325 000 Livres sechstausend Mann zur steten Verfügung des französischen Hofes zu halten. Das beste an dem schmählichen Handel war noch, daß der Herzog das Sündengeld verpraßte, ohne seine Verpflichtung zu erfüllen, allein er brauchte immer mehr, um seine wachsenden Lüste zu befriedigen, und so begann er in der Mitte der fünfziger Jahre ein Willkürregiment, das die nicht geringen Leistungen seiner glorreichen Ahnen auf diesem Gebiete weit überflügelte. Insbesondere richtete er sich, nachdem er sich von seiner Gemahlin getrennt hatte, einen großen Harem ein, den er nicht nur mit den kostspieligsten Buhldirnen aus Frankreich und Italien bevölkerte, sondern auch aus den Töchtern des Landes gewaltsam ergänzte, unter furchtbaren Strafandrohungen für jede Widersetzlichkeit der Familien, denen er die Frauen und Töchter raubte, sobald sie sein sultanisches Wohlgefallen erregt hatten.
Inzwischen brach im Jahre 1756 der Siebenjährige Krieg aus. Frankreich verlangte seine gekauften Truppen, die nicht da waren. Zugleich stand von vornherein fest, daß die Landschaft ihre zu einer Truppenaushebung notwendige Genehmigung unter keinen Umständen erteilen würde, da der Krieg gegen das protestantische Preußen bei der gesamten Bevölkerung verhaßt war. Jedoch fand der Herzog in dem Hauptmann Rieger ein geeignetes Werkzeug für eine gewaltsame und widerrechtliche Massenaushebung. Ursprünglich Jurist und Auditeur in einem preußischen Regiment, war Rieger ein herrschsüchtiger, hochmütiger und zwar persönlich unbestechlicher, aber im Despotendienste zu jeder Gewaltsamkeit und Niederträchtigkeit bereiter Mann. Er verstand den Menschenraub zu organisieren, indem er die jungen Männer nachts aus ihren Betten reißen oder während des Gottesdienstes in der Kirche überfallen ließ. Als der so gepreßte Haufen aus Stuttgart ausrücken sollte, meuterte er mit Hilfe der Stuttgarter Bürgerschaft und lief auseinander, so daß von 3 200 Mann nur 400 bei der Fahne blieben. Indessen wußte Rieger einen großen Teil wieder zusammenzubringen, indem er Generalpardon für sofortige Rückkehr verhieß und die schwersten Strafen für beharrliches Fortbleiben androhte. Sobald die Truppe erst auf dem Marsche war, wurden wiederholte Meutereien durch summarisches Erschießen der Rädelsführer erstickt. Daneben liefen aber massenhafte Desertionen einher, und der spärliche Rest, der endlich zum österreichischen Heere stieß, gab in der Schlacht bei Leuthen das erste Signal zur Flucht.
Darüber erbost, wollten die Osterreicher von diesen Mitkämpfern nichts mehr wissen, und im Jahre 1758 wurde das württembergische Kontingent in die französische Armee untergesteckt. Der sechsjährige Subsidienvertrag lief damit ab, aber Herzog Karl erbot sich, für das Jahr 1759 nun gar noch zwölftausend Mann zu stellen, natürlich gegen höhere Subsidien - im ganzen hat er neun Millionen Livres von Frankreich bezogen - und unter der Bedingung, daß er den Oberbefehl führe, da ihm seine Ehre verbiete, unter einem französischen Marschall zu dienen. Der Pariser Hof ging auf den Vorschlag ein, und Rieger mußte wieder eine gewaltsame Massenaushebung unter den grausamsten Mißhandlungen der Bevölkerung veranstalten. Auch diesmal kam er zum Ziele, wenn die neue Mannschaft auch erst Ende Oktober 1759 marschfertig wurde.
Vorher war es noch zum völligen Bruche zwischen dem Herzog und den Ständen gekommen. Sie protestierten gegen die unausgesetzten Eingriffe in ihre Rechte, wurden aber durch den Grafen Montmartin, den sich der Herzog als Minister zugelegt hatte, einen geschmeidigen und ränkevollen, dabei auch - im Gegensatze zu Rieger - feigen und feilen Höfling beschieden, daß sie unbedingten Gehorsam zu leisten hätten. Im Sommer 1759 verlangte der Herzog die Auslieferung der landschaftlichen Steuerkasse und ließ sie einfach, als die Stände sich dagegen sträubten, mit militärischer Gewalt wegnehmen. Dabei verhaftete er den Rechtskonsulenten der Landschaft, J. J. Moser, mit eigener Hand und ließ ihn in die Bergveste Hohentwiel eintürmen. Hier saß der alte Mann, der überall in Deutschland wegen seiner großen Gelehrsamkeit und seines redlichen Charakters geachtet war, in tiefer Gefängnisnacht, blutiges Fleisch und Eingeweide seine Kost, faules Wasser voll ekelhaften Gewürms sein Getränke, zur Winterszeit fast das Mark in den Gebeinen erfrierend. Die Landschaft aber, für die er litt, zeigte auch bei dieser Gelegenheit die Gebrechlichkeit einer feudalen Körperschaft: sie trat erst spät und nicht eben energisch für Moser ein.
Nach dieser Heldentat zog der Herzog ins Feld, doch wurde er schon, kaum einen Monat nachdem er ausgerückt war, als er am 30. November 1759 in Fulda einen Ball geben wollte, um die Niederlage der preußischen Waffen bei Maxen zu feiern, durch den Erbprinzen von Braunschweig überfallen und mußte einen wahrhaft falstaffmäßigen Rückzug antreten. Nun hatte auch Frankreich an diesem Bundesgenossen genug und erneuerte den Subsidienvertrag nicht mehr. Ein letzter Versuch des Herzogs gelang dann noch einmal bei Österreich, das im Jahre 1760 für 11 000 Mann württembergischer Truppen die Bagatelle von 50 000 Gulden zahlte und daneben oder vielmehr in der Hauptsache versprach, daß der Reichshofrat in Wien taube Ohren für die Klagen der Stände haben werde. Allein als der Herzog nun gegen Sachsen und Thüringen hin aufbrach, wurde es weniger ein Kriegs- als ein Raubzug, der sich wieder in allgemeine Heiterkeit auflöste, als Karl Eugen bei Köthen von seinem jüngsten Bruder Friedrich Eugen, der preußischer General geworden war, mit leichter Mühe in die wildeste Flucht gejagt wurde. Nun war mit der Seelenverkäuferei auch nicht einmal mehr ein Heller zu verdienen, obgleich dieser deutsche Landesvater deshalb nicht nur an die französische und die österreichische, sondern auch an die englische und die spanische Tür pochte.
Immer aber hatte er die Soldatenspielerei nicht satt und unterhielt noch im Jahre 1762 eine Truppenmacht von 14 000 Mann, darunter 18 Generale, 6 General- und 7 Flügeladjutanten, 22 Oberste, alles in allem 735 Offiziere. Die Kosten wurden durch immer gesteigerte Pressung des Landes herausgeschlagen. Montmartin war unerschöpflich in der Erfindung widergesetzlicher Steuern und fand dabei gleich raffinierte Gehilfen, wie Lorenz Wittleder, dessen Spezialitäten ein ehrloser Ämterschacher und freche Angriffe auf den Kirchenkasten waren. Dagegen gerieten sich Montmartin und Rieger als Hauptnebenbuhler um die Gunst des Despoten in die Haare. Durch gefälschte Briefe wußte Montmartin beim Herzoge den Verdacht zu erwecken, daß Rieger mit dem Prinzen Friedrich Eugen heimliche Beziehungen unterhalte. Im November 1762 wurde eines Tages der ahnungslose Rieger auf dem Paradeplatz in Stuttgart verhaftet - durch Montmartin und den Herzog selbst, der gern den eigenen Henkersknecht spielte - und ohne Untersuchung und Urteil nach dem Hohentwiel geschleppt, wo er mehr als vier Jahre in einem unterirdischen Gewölbe, ohne ein Menschenantlitz zu sehen, gefangengehalten wurde. Erst 1767 kam er wieder frei, auf Verwendung der Stände, die, wie es scheint, für einen ihrer schlimmsten Peiniger größeres Interesse gehabt haben als für ihren Vorkämpfer Moser.
Zu dieser Zeit hatten die württembergischen Dinge aber überhaupt eine andere Wendung genommen.
Kinderzeiten
In den tragikomischen Feldzügen des Herzogs war auch Schillers Vater mitmarschiert. Er half, wie die bürgerliche Literarhistorie rühmend meldet, "in treuer Hingabe" die meuternden Truppen bändigen. So rückte er schnell zum Fähnrich auf, und dann auch zum Leutnant, nachdem er, ein frommer Mann, in den böhmischen Winterquartieren nach der Schlacht bei Leuthen seine Leute "in einiger Religionsverfassung" gehalten und auch seine alten Feldscherkünste wieder hervorgesucht hatte, als eine bösartige Seuche im Lager ausbrach.
In der langen Zeit, die Rieger brauchte, um im Jahre 1759 die neuen zwölftausend Mann als französisches Kanonenfutter zu pressen, lag der Leutnant Schiller in einer Garnison unweit Marbachs und kam häufig mit seiner Gattin zusammen. Sie trug ein Kind unterm Herzen, als Ende Oktober endlich der Ausmarsch erfolgte, und es heißt, daß die Vorzeichen der Geburt sie überrascht hätten, als sie im Lager von Ludwigsburg erschienen sei, um sich von ihrem Manne zu verabschieden. Allein wenn gesagt worden ist, daß der Ungeborene schon den kriegerischen Hall der Waffen vernommen habe, so war die herzoglich württembergische Sorte "kriegerischen Halls" wenig dazu angetan, den Dichter des "Wallenstein" zu erwecken. Ungleich nüchterner und trauriger klingt es, ist aber leider ebenso viel wahrscheinlicher, daß die Angst und Sorge der Mutter um das unruhige Kriegsleben des Vaters die Schwächlichkeit des Knaben verursacht habe, der am 10. November 1759 geboren wurde. So bezeugt seine ältere Schwester, die ihn um mehr als vierzig Jahre überlebt hat, wie denn auch die Eltern ein hohes Alter erreichten.
Seine ersten Lebensjahre verlebte der kleine Friedrich unter der alleinigen Obhut der Mutter, die in ärmlichen Verhältnissen hauste; als Wächter des Niklastores in Marbach fristete der verarmte Gastwirt Kodweiß ein kümmerliches Dasein. Auch blieb Schmalhans noch Küchenmeister, als sich Ende 1763 die Gatten wieder vereinigten und ihren Wohnsitz in dem Dorfe Lorch an der württembergischen Grenze nahmen.
Der nunmehrige Hauptmann Schiller war hierher als Werbeoffizier kommandiert worden. Man hat ihn deshalb zu entschuldigen gesucht und namentlich gesagt, er habe anfangs nicht gewußt, daß die geworbenen Truppen an Holland zum Dienst in überseeischen Kolonien verkauft werden sollten, und sich, sobald es bekannt wurde, mit Unlust zu dem traurigen Geschäft hergegeben. Jedoch ist dies Gerede nur charakteristisch für den blinden Eifer der bürgerlichen Literarhistoriker, die gleich mit dem Beschönigungspinsel losfahren, weil sie einmal von Schubarts Kapliede und Schillers "Kabale und Liebe" gehört haben.
Der Menschenschacher, den der Herzog mit Holland trieb, fiel erst zwanzig Jahre nach dem Werbedienste des Hauptmanns Schiller in Lorch, und an diesem Dienst als solchem nahm damals kein Offizier irgendwelchen Anstoß. Auch der zarte Frühlingssänger v. Kleist hat als preußischer Offizier den Menschenfang in der Schweiz ohne alle Gewissensbisse betrieben und deshalb selbst Lessings Freundschaft nicht eingebüßt. Im übrigen ist mit einiger Sicherheit anzunehmen. daß der Werbeoffizier Schiller kein großes Unheil angerichtet hat, denn zum Werben gehörte Geld, und er hat in dieser Lorcher Zeit bei den ewigen Geldnöten des Herzogs selbst sein bißchen Gehalt nur saumselig oder auch gar nicht erhalten.
Eher fällt ein Schatten auf ihn durch die "treue Hingabe", die er im Siebenjährigen Kriege dem herzoglichen Dienste geleistet hat und durch die Gnade. die er bei Rieger genoß, den er zum Taufpaten seines Sohnes wählen durfte. Doch der tüchtige Kern seines Wesens arbeitete sich durch alle Wirrnis einer elenden Zeit hindurch, und obgleich er sogar noch dem herzoglichen Dienste eine gedeihliche und gemeinnützige Tätigkeit abgewinnen sollte, so ist er von Anfang an für seinen Stammhalter auf ein besseres Los bedacht gewesen. In Lorch entwickelten sich die ersten Charakterzüge des Knaben in einer Weise, die auch wir noch erkennen können. Die Plage der Eltern minderte nicht die Lust der Kinder, die sich, wie die Schwester den Bruder noch kurz vor seinem Tode erinnerte, in Lorch "vorzüglich wohl" befanden. Landschaftliche Reize verknüpften sich hier mit historischen Erinnerungen. Lorch ist eine altrömische Niederlassung, in seiner unmittelbaren Nähe erhob sich die Stammburg der Hohenstaufen, und in seiner Umgebung trat dem Knaben zuerst die katholische Welt leibhaftig entgegen. Hier empfing er von einem würdigen Pfarrer den ersten Unterricht, und hier verkündete sich seine erste Neigung, den geistlichen Beruf zu ergreifen. Nicht als ob er ein Duckmäuser und Kopfhänger gewesen wäre, aber aufgeweckt, gutherzig, munter, lustig unter lustigen Gespielen, wie er war, hatte er seine nachdenklichen und träumerischen Stunden, und früh prägte sich ein lehrhafter Zug in ihm aus, indem er von einem Stuhle wie von einer Kanzel herab seine Bibelsprüche und Gesangbuchverse predigte.
Diese Neigung des siebenjährigen Knaben haben die Eltern durchaus gehegt und gepflegt, die Mutter wie der Vater, dem neben aller Frömmigkeit die Erwägung nahe getreten sein mag, daß ein württembergischer Prälat auch in weltlichen Landessachen mehr bedeute als ein halbverhungerter Werbeoffizier. Als er Ende 1766 in ein Ludwigsburger Regiment versetzt wurde, brachen freundlichere Tage für die Familie herein, aber das Leben in der Fürstenresidenz änderte für Friedrich nichts an dem, was in dem idyllischen Lorch herangereift war. Ludwigsburg gehörte zu jenen künstlichen Stadtgründungen, in denen sich im 18. Jahrhundert die Launen der kleinen Despoten gefielen. Der Herzog Eberhard Ludwig hatte die Stadt wenige Jahrzehnte vorher erbaut, um die Stuttgarter zu strafen, weil sie seiner Dirne Grävenitz nicht die gebührende Reverenz erwiesen; nach seinem Tode halb schon wieder verfallen, wurde sie von Karl Eugen von neuem aufgebaut, ebenfalls um das unbotmäßige Stuttgart zu züchtigen. Gerade in den sechziger Jahren sah Ludwigsburg all die zuchtlose Verschwendung des schwäbischen Sultans, seinen Hofstaat von zweitausend Personen, darunter zweihundert Edelleute, zwanzig Prinzen und Reichsfürsten, seinen Marstall von achthundert Pferden, seine italienischen Sänger und Tänzer, seine Bälle, Konzerte, Redouten, Schlittenfahrten, Illuminationen, Feuerwerke und Jagden. Dabei gab die dürftig zusammengeflickte Stadt, in der manches Gebäude schon zusammenbrach, ehe es noch unter Dach gebracht worden war, den passenden Hintergrund ab für die trügerische Herrlichkeit.
Alles das hat der Knabe Schiller sechs Jahre lang mit angesehen, und es blieb seinem Gedächtnis unverloren. Doch hat, wenn der Bericht seiner Schwester nicht irrt, die italienische Oper auch zuerst sein lebhaftes Interesse für das Theater erweckt; den Offizieren war der freie Eintritt gestattet, und zur Belohnung seines Fleißes durfte der kleine Fritz den Vater mitunter begleiten. An dem geistlichen Berufe machte ihn sein kindliches Theaterspielen aber nicht irre, so wenig wie die strenge Orthodoxie, die ihm auf der Lateinschule in Ludwigsburg eingebläut wurde. Er machte diese Schule mit gutem Erfolge durch, als ein Zögling, der vortreffliche Hoffnungen erwecke, und war eben reif, in eine Klosterschule aufzurücken, als ihn ein Schlag traf, der ihn in ein neues Geleise warf.
Auf der Karlsschule
Mit dem Jahre 1770 hatte der Krieg zwischen dem Herzog und den Ständen sein Ende erreicht; in dem Erbvergleiche dieses Jahres wurden die Rechte der Landschaft von neuem verbrieft, unter der Bürgschaft der protestantischen Mächte England, Dänemark und Preußen.
Eben diese Mächte hatten dem Reichshofrat in Wien eingeheizt, bis er dem landverwüstenden Treiben des Herzogs eine gewisse Schranke zog. Besonders der alte Fritz nahm mit allem Nachdruck seine Revanche für die stupide Bosheit, womit ihn Karl Eugen bekriegt hatte; er sandte einen Bevollmächtigten nach Stuttgart mit dem Befehl, bei der geringsten Schwierigkeit einen hohen Ton anzuschlagen und scharfe Zähne zu zeigen, und seinen Gesandten in Wien ließ er erklären, daß er, wenn der Reichshofrat nicht eine "prompte und unparteiische Erkenntnis" fälle, "solche Maßregeln vorkehren würde, wodurch denen Ständen und dem armen Lande Hilfe und Erleichterung geschafft werden könnten". Bereits ein Jahr nach dem Frieden setzte er die Freilassung Mosers durch, zwei Jahre darauf gab der durchtriebene Halunke Montmartin das Spiel verloren, und im Jahre 1770 kapitulierte der Herzog selbst, zumal da ihm der völlige Ruin des Landes kaum noch eine Wahl ließ.
Immerhin wurde er nur durch eine gewisse Schranke eingeengt, und wie die Stände nicht aus eigener Kraft gesiegt hatten, so erwiesen sie sich auch unfähig, seinem Unwesen gründlich zu steuern. Es gibt keine Schandtat, die der Herzog vor 1770 begangen und nach 1770 nicht wiederholt hätte. Die Eintürmung Mosers fand ein noch ruchloseres Seitenstück in der Eintürmung des Dichters Schubart, den der Herzog 1777 durch falsche Vorspiegelungen über die Grenze locken und dann zehn Jahre lang auf dem Hohenasperg mißhandeln ließ, ohne Urteil und Recht; man weiß heute noch nicht einmal genau, aus welchem Grunde; jedenfalls aber nur, weil Schubart irgendein Wort geäußert hatte, das dem Herzog oder seiner Mätresse mißfiel. Auch die Seelenverkäuferei aus dem Siebenjährigen Kriege wiederholte sich in womöglich noch infamerer Form, als der Herzog 1786 einen Subsidienvertrag mit der holländisch-ostindischen Kompanie schloß, durch den er gegen eine jährliche Summe von 65 000 Gulden ein Infanterieregiment und eine Artilleriekompanie zum Dienst am Kap verkaufte. Außerordentliche Geldforderungen, Eingriffe in die Verfassung, Auferlegung ungesetzlicher Lasten hörten nicht auf, auch der Ämterschacher nicht, so feierlich der Herzog sich durch sein "bündigstes, heiligstes Fürstenwort" verpflichtet hatte, den schmählichen Unfug zu unterlassen. Selbst daß er seinen Harem verabschiedete und sich fortan mit einer Favoritin begnügte, einer adeligen Person, die er durch den Kaiser zur Reichsgräfin von Hohenheim ernennen ließ, war an sich noch kein Zeichen von Besserung; im Gegenteil fürchteten die deutschen "Untertanen" des achtzehnten Jahrhunderts, aus ihrer in diesem Punkte ungemein reichen und vielseitigen Erfahrung, das einschläfrige Mätressenwesen noch weit mehr als das vielschläfrige. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Hohenheim die Einkerkerung Schubarts veranlaßt hat; jedenfalls stand die Dirne mit ihrem Buhlen hohnlachend dabei, als Schubart in ein dunkles Verlies des Hohenaspergs gestoßen wurde.
Nicht sowohl eine bessere, als eine andere Richtung nahmen die perversen Neigungen des Herzogs an, als sie sich nach dem Einspruche der protestantischen Mächte nicht mehr ganz ungehindert austoben konnten. In wüsten Ausschweifungen früh gealtert, versuchte er die Rolle eines aufgeklärten und philosophisch denkenden Despoten zu spielen; im Jahre 1778 erließ er, an seinem fünfzigsten Geburtstage, ein Manifest, worin er seine Sünden bekannte und für die Zukunft besser zu regieren versprach. "Württembergs Glückseligkeit soll von nun an und für immer auf der Beobachtung der echtesten Pflichten des getreuen Landesvaters gegen seine Untertanen und auf dem zärtlichsten Gehorsam der Diener und Untertanen gegen ihren Gesalbten beruhen." Am eigentümlichsten kennzeichnete sich die "Besserung" des Herzogs in der Wendung, die seine Soldatenspielerei nahm. Er konnte jetzt nur noch eine Kriegsmacht von drei- bis viertausend Mann unterhalten, die freilich immer noch von zwei Generalleutnants und acht Generalmajoren befehligt wurde; dafür gründete er 1770 auf der Solitüde, einem Lustschlosse in der Nähe von Ludwigsburg, ein Militärwaisenhaus, das er schnell zu einer Militärpflanzschule und dann zu einer Herzoglichen Militärakademie erweiterte, später sogar vom Kaiser mit den Rechten einer Universität versehen ließ und Hohe Karlsschule taufte.
Trotz ihres anfänglichen militärischen Namens sollte diese Anstalt nicht nur Offiziere, sondern auch Beamte und Künstler heranbilden. Soweit ein sozusagen politischer Gedanke bei ihrer Gründung mitspielte, war sie als Gegengewicht gegen die Landesuniversität in Tübingen geplant, die unter dem Einfluß der Landschaft stand. Sie sollte der herzoglichen Gewalt einen Stamm blind ergebener Werkzeuge erziehen. Schubart nannte sie eine "Sklavenplantage", und eben dies war sie; Leben und Unterricht der Zöglinge waren nicht nur nach der strengsten militärischen Disziplin geregelt, sondern die jungen Leute wurden geradezu wie Gefangene gehalten; sie bekamen nie einen Tag Ferien, durften keinen unkontrollierten Briefwechsel mit der Außenwelt führen, sogar ihre Eltern nur in Gegenwart von Aufsehern sprechen. Unter den Schülern selbst wurde jeder kameradschaftliche Sinn zu ersticken gesucht; sie mußten sich gegenseitig ausspionieren und zerfielen in Kavaliers, Offizierssöhne, Honoratiorensöhne und Bürgerliche, über denen allen dann zur Auszeichung der dienstwilligsten Subjekte noch eine Klasse von Großrittern eingerichtet wurde. Hündische Kriecherei vor dem Herzoge war das belebende Prinzip der Anstalt, und an ihr tobte er nun seine despotischen Narreteien in dem Maße aus, wie sie ihm sonst eingeschränkt worden waren.
So auch preßte er die Zöglinge wie ehedem die Rekruten im Siebenjährigen Kriege, und unter den Opfern, die er gewaltsam dem Schoß ihrer Familie entriß, befand sich der dreizehnjährige Friedrich Schiller. Vergebens protestierte der Vater unter Berufung darauf, daß sein Sohn den geistlichen Beruf zu erwählen gedächte und eine theologische Fakultät an der Militärakademie nicht bestände; er wurde mit dem Bescheide abgewiesen, daß der Knabe dann Rechtswissenschaft studieren könnte. Als herzoglicher Offizier mußte sich der Vater schließlich fügen und durfte noch froh sein, daß der Herzog versprach, den gezwungenen Zögling nach dem Austritt aus der Akademie besser zu versorgen als im geistlichen Stande möglich sein würde. Am 16. Januar 1772 wanderte der junge Schiller in die Karlsschule, und erst acht Jahre später, gegen Ende des Jahres 1780, hat er sie verlassen.
Mit dem Studium der Rechtswissenschaft hat er sich nicht lange aufgehalten, es war ihm zu trocken und ungenießbar. Sobald eine medizinische Fakultät eingerichtet wurde, trat er in sie über; es geschah im November 1775, als die Anstalt nach Stuttgart verlegt wurde, das sich durch eine tüchtige Handsalbe die "Versöhnung" mit dem Herzoge erkauft hatte. Zu gleicher Zeit, wo Schiller die Solitüde verließ, siedelten seine Eltern dahin über; der Vater wurde zur Leitung einer großen Baumschule berufen und genoß nun nach allen Wechselfällen seines bewegten Lebens als geschickter und erfolgreicher Baumzüchter noch ein paar friedliche Jahrzehnte.
Um so bedrängter gestaltete sich das Leben des Sohnes. Alle Schönfärberei beseitigt die Tatsache nicht, daß er sich im Joche der "Sklavenplantage" die Schultern wund gescheuert hat. Wohl hat er der Karlsschule, als sie nach dem Tode ihres Gründers aufgelöst wurde, das bedingte Verdienst zugesprochen, in Stuttgart künstlerisches und wissenschaftliches Interesse verbreitet zu haben, doch sind die anerkennenden Worte, die er über den eben gestorbenen Karl Eugen zu einem ehemaligen Mitschüler gesprochen haben soll, von diesem loyalen Schwaben entweder mißverstanden oder verdreht worden: sie stehen im schroffsten Gegensatze zu der verächtlichen Gleichgültigkeit, womit Schiller in einem gleichzeitigen Briefe "den Tod des alten Herodes" verzeichnet. Er hat niemals ein Gefühl der Dankbarkeit für den Despoten gehabt, der über ihn "eine traurige düstere Jugend", eine "wahnsinnige Methode der Erziehung" verhängt hatte; die pädagogischen Trödeleien des Herzogs hat er treffend und noch milde genug mit den Worten gekennzeichnet: "Der gegenwärtige Kitzel, mit Gottes Geschöpfen Christmarkt zu spielen, diese berühmte Raserei, Menschen zu drechseln und es Deukalion gleichzutun (mit dem Unterschiede freilich, daß man aus Menschen nunmehr Steine macht, wie jener aus Steinen Menschen), verdiente es mehr als jede andere Ausschweifung der Vernunft, die Geißel der Satire zu fühlen."
Von dem Leben Schillers auf der Karlsschule ist verhältnismäßig wenig bekannt geworden. Was einige seiner Mitschüler darüber berichtet haben, rührt erst aus der Zeit nach seinem Tode her, ist also aus einer um Jahrzehnte zurückliegenden Erinnerung geschrieben und hat geringen Wert, zumal da keiner seiner damaligen Genossen über eine biedere Mittelmäßigkeit emporragte. Der tüchtigste von ihnen war wohl der spätere Generalleutnant Scharffenstein, mit dem Schiller auch am nächsten befreundet gewesen ist. Wichtiger als alle diese Mitteilungen sind die urkundlichen Zeugnisse, die sich von der Hand des Karlsschülers selbst erhalten haben.
Das älteste davon gibt zugleich eine Probe von den schmählichen Erziehungspraktiken des Herzogs. Er legte im Jahre 1774 den Zöglingen eine Beichte über sich und ihre Kameraden auf. Ob er Gottesfurcht hege, wie er über den Herzog und seine Lehrer denke, ob er mit sich und seinem Schicksal zufrieden sei - diese und ähnliche Fragen hatte jeder Zögling schriftlich zu beantworten, nicht nur über sich, sondern auch über seine Genossen. Der fünfzehnjährige Schiller hat sich leidlich genug aus der argen Falle gezogen, mit einem gewissen Maße von Weltklugheit, das im Knaben schon den kommenden Mann ankündigt. In seiner Beichte fehlt es nicht an manchem altklugen und vorlauten Wort, aber im ganzen urteilt er mit mildem Wohlwollen über seine Leidensgenossen, und ihrem eigenen Urteile über ihn beugt er mit der vorsorglichen Wendung vor: "Sie werden mich eigensinnig, hitzig, ungeduldig hören müssen, doch werden dieselben Ihnen auch meine Aufrichtigkeit, meine Treue, mein gutes Herz rühmen." Sich selbst klagt er an: "Sie werden mich öfters übereilend, öfters leichtsinnig finden, aber ist es denn notwendig, daß Vergehungen dasjenige umstoßen, was Vertrauen und Liebe zu Gott aufgebaut haben, und was ein von Natur empfindbares Herz sich zum Grundgesetze machte?" Er entschuldigt sich mit körperlichen Leiden, wenn er von seinen "schönen Gaben" noch nicht den Gebrauch gemacht habe, den ihm seine Pflicht auferlege, und nicht zum wenigsten nimmt es für den kleinen Kerl ein, daß er dem gefürchteten Despoten keck ins Gesicht wiederholt, wie viel glücklicher er sein würde, wenn er nicht als Rechts-, sondern als Gottesgelehrter seinem Fürsten und Vaterlande dienen könne.
Die Berichte, die seine Mitschüler bei diesem Anlaß über ihn erstattet haben, heben in großer Übereinstimmung seine Neigung zur Dichtkunst und namentlich zur tragischen Poesie hervor. Dagegen gehen sie auseinander, indem die einen ihn lebhaft und munter, die anderen schüchtern und in sich zurückgezogen nennen. Was sich in diesen zwiespältigen Urteilen widerspiegelt war ein Zwiespalt in Schillers Wesen selbst.
Einen ungleich ungünstigeren Eindruck als jene Beichte des Knaben machen einige Festreden des nun doch schon um vier oder fünf Jahre älteren Jünglings. Auch sie wurden durch den Herzog erzwungen, der pomphafte Spektakelstücke in der Karlsschule liebte; nicht um ihre Zöglinge dafür zu entschädigen, daß er ihnen alle Freuden der Jugend raubte, sondern um sich und seine Kebse schamlos beweihräuchern zu lassen. So ist auch der arme Schiller gepreßt worden, im Januar 1779 und 1780 zum Geburtstage der Hohenheim diesen Tugendspiegel mit blödem Bombast über die Tugend und ihre segensreichen Folgen zu feiern; der zwanzigjährige Jüngling, der in nächtlicher Weile über einem revolutionären Drama brütete, mußte die dreißigjährige Dirne anstammeln: "Durchlauchtigster Herzog! Nicht mit der schamrotmachenden Heuchelrede kriechender Schmeichelei (Ihre Söhne haben nicht schmeicheln gelernt) - nein, mit der offenen Stirn der Wahrheit kann ich auftreten und sagen: Sie ists, die liebenswürdige Freundin Karls - Sie, die Menschenfreundin! - Sie, unser aller besondere Freundin! Mutter! Franziska!" Auch seinen Pegasus mußte er mehr als einmal vor "Franziskens holdem Himmelsbild" scharren und springen lassen.
Was die Karlsschule wissenschaftlich für Schiller gewesen ist, verraten die beiden Abhandlungen, durch die er zeigen sollte, wie er ihren Kursus durchschmarutzt habe, die eine über die Philosophie der Physiologie, die andere über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Die erste, aus dem Jahre 1779, ist nur in einem handschriftlichen Bruchstück erhalten, da sie nicht zum Drucke zugelassen wurde, weil sie noch zuviel jugendliches Feuer zeige; auf diese Arbeit hin entschied der Herzog, daß Schiller noch ein Jahr auf der Akademie zu bleiben habe. Die andere, aus dem Jahre 1780, ist durch den Druck veröffentlicht worden; sie verschaffte ihrem Verfasser endlich die lang ersehnte Freiheit.
Mit seinen medizinischen Fachkenntnissen berühren sich beide Arbeiten nur mittelbar; ihr Schwerpunkt liegt in ihren philosophischen Erörterungen. Sie zeigen den jungen Denker schon inmitten eines Problems, das ihn wieder und wieder beschäftigen sollte, weit über die Zeit hinaus, wo er auf den Bänken der Karlsschule saß - ja im Grunde bis an das Ende seines Lebens. Die "Mittelkraft", die er in der "Philosophie der Physiologie" als das Verbindungsglied zwischen Geist und Materie entdeckt, die "Mittellinie der Wahrheit", die er in der anderen Abhandlung gefunden haben wollte, im "Gleichgewicht zwischen den beiden Lehrmeinungen", von denen die eine die Materie über den Geist, die andere den Geist über die Materie stellt - sie sind die ersten Versuche, einen Dualismus zu überwinden, den Schiller niemals überwunden hat, und es ist bezeichnend genug, daß diese Versuche trotz ihrer übereinstimmenden Tendenz doch hin und her schwanken, der erste mehr nach der spiritualistischen, der zweite mehr nach der materialistischen Seite hin.
Unter diesem Gesichtspunkte haben die beiden Abhandlungen heute noch ein großes Interesse. Sonst aber stellen sie dem wissenschaftlichen Unterrichte der Karlsschule das dürftigste Zeugnis aus und enthüllen an ihrem Teile die ganze Hohlheit des liebedienerischen, selbst noch von Treitschke wiederholten Geredes, daß Karl Eugen, um den freien Gedanken des neuen Jahrhunderts gegenüber der starren Theologie des Tübinger Stiftes den Einzug in Württemberg zu verschaffen, die Karlsschule gegründet habe, durch deren verweltlichte Wissenschaft der Ruhm der alten Hochschule ganz verdunkelt worden sei. Allerdings konnte der Herzog aus Angst vor den Ständen keine katholische und aus Haß gegen die Stände keine evangelische Theologiefakultät an der Karlsschule errichten, aber was er dafür an ihr heimisch machte, war eine seichte Popularphilosophie, eine Sammlung von Gemeinplätzen, die halb nach Leibniz und Wolff, halb nach Shaftesbury und Ferguson schielten und sich schließlich in ein paar Redensarten von Glückseligkeit und Tugend erschöpften, von der Glückseligkeit, die Herzog Karl seinen "Söhnen" in der Karlsschule spendete, und von der Tugend, die seine Mätresse Franziska strahlend in sich verkörperte.
Eben diese Arbeiten Schillers, von denen auch die abgewiesene nach dem Urteile des Herzogs ein "recht großes Subjektum" verriet, offenbaren einen gänzlichen Mangel an jener wissenschaftlichen Schulung, die zu geben die eigentliche Aufgabe einer wissenschaftlichen Schule ist. Um den Mangel auszugleichen, hat Schiller später kostbare Jahre, Jahre der blühendsten Manneskraft opfern müssen, und er selbst hat bitter genug die Verkümmerung seiner spekulativen Anlagen durch die Karlsschule beklagt. "Ich bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Kenntnissen, ich habe keine philosophische Schule gehört und wenig gedruckte Schriften gelesen", schreibt er fünf Jahre später, und wieder drei Jahre später bekennt er, daß ihn das Gefühl seiner Armseligkeit nie so überkomme wie bei philosophischen Arbeiten. Er habe so wenig über diese Materie gelesen, und es seien so viele vortreffliche Schriften darüber vorhanden, die man sich ohne Schamröte nicht anmerken lassen könne, nicht gelesen zu haben. Etwa zur Zeit, wo Schiller so schrieb, verließen das Tübinger Stift zwei Jünglinge, deren Namen man nur zu nennen braucht, um zu zeigen, was Schiller durch die Karlsschule verloren hat: sie hießen Hegel und Schelling.
Und dennoch - als Schiller endlich erlöst war und einen Jugendgespielen aus Lorch traf, der den gemeinsamen Jugendplan, in Tübingen Theologie zu studieren, hatte ausführen dürfen, meinte er lachend: "Was wäre ich denn? Ein Tübingisches Magisterchen." Allein der so sprach, war nicht der Zögling der Karlsschule, sondern der Dichter der "Räuber".
Franz Mehring